Ein Artikel dazu erschien am 15.11.2023


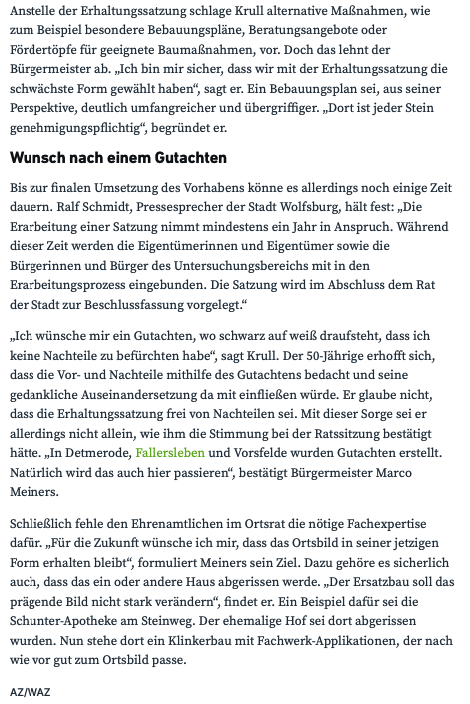

Ein Artikel dazu erschien am 15.11.2023


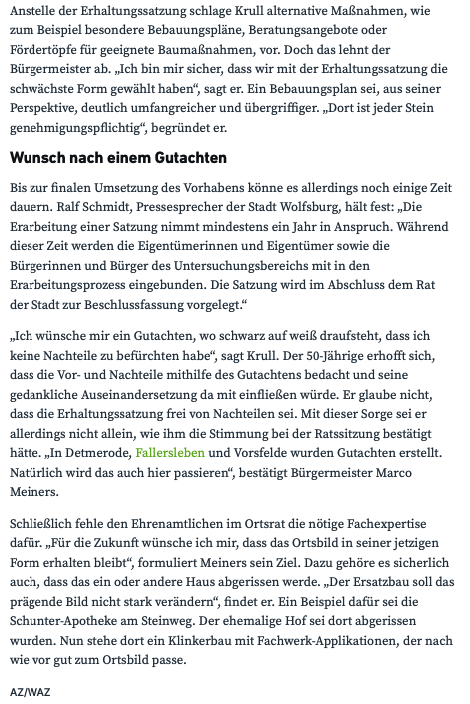
Meine Bedenken über den vom Ortsrat WOB-Heiligendorf im Herbst 2023 eingebrachten Antrag hinsichtlich einer Erhaltungssatzung für das Dorf Heiligendorf, habe ich in einem Brief an den Oberbürgermeister Dennis Weilmann der Stadt Wolfsburg zum Ausdruck gebracht.
Nachfolgend meine Zeilen:
Sehr geehrter Herr Weilmann,
in der 16. Ratssitzung am 06.12.2023 wird der TOP „Erhaltungssatzung Heiligendorf“ behandelt. Mit meinem Fachwerkhaus in Heiligendorf gehöre ich zu denjenigen, die von einer Erhaltungssatzung nach §172 BauGB betroffen wären. Zu dem Thema „STÄDTEBAULICHE Erhaltungssatzung“ habe ich mich, soweit es mir möglich war, sachkundig gemacht.
Die beigefügten Ausschnitte aus dem Buch „Soziale Erhaltungssatzung und soziale Erhaltungsverordnung“ von Prof. Kment (Universität Augsburg) und einige weitere Artikel behandeln das Thema „SOZIALE Erhaltungssatzung“ und sind etwas anders gelagert. Die Konsequenzen, die aus dieser resultieren, treffen meines Erachtens aber auch auf die „Städtebauliche Erhaltungssatzung“ zu.
Ich halte das Instrument „Erhaltungssatzung“ als städtebauliche Schutzmaßnahme für sehr bedenklich, weil es tief ins Eigentum des Bürgers eingreift und zu Lasten der Hauseigentümer geht. Was die Lasten betrifft, ist es beim Denkmalschutz etwas anders. Der Staat weiß, dass er sich nicht um alle schützenswerten Gebäude kümmern kann und überlässt sie den Bürgern, aber räumt wenigstens die Möglichkeit einer erhöhten Abschreibung (9%) ein.
Die gut gemeinte Erhaltungssatzung verkehrt sich schnell ins Gegenteil, d.h. sie führt zum Erliegen der Dorf-/Stadtentwicklung. Dieser Umstand tritt ein, weil die Eigentümer ihre Investitionen, aufgrund der durch die Erhaltungssatzung verursachten Mehraufwände, einstellen. Die von der Bundesregierung dringend gewünschten zukunftsorientierten Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden werden dann – trotz Fördermöglichkeit – nicht umgesetzt. Findet das nicht statt, ist der Verfall der Häuser programmiert.
Darüber hinaus habe ich Zweifel, ob die Entscheidung im Ortsrat Heiligendorf/Hattorf am 08.11.2023, zur Initiierung einer Erhaltungssatzung, rechtlich tragfähig ist. Aus meiner Sicht hat sich der Ortsrat von den Dorfbewohnern kein repräsentatives Stimmungsbild eingeholt. Eine Abstimmung lediglich im Verein Heiligendorfer Kultur- und Brauchtumspflege ist unbrauchbar, da deren Mitglieder in einem nicht ausreichenden Maße die Dorfbewohner abbilden. Ob die Mehrheit der Dorfbewohner eine Erhaltungssatzung tatsächlich wünscht, ist nach meiner Auffassung völlig offen.
Fragwürdig ist auch, warum der Ortsrat eine solch gewichtige Entscheidung trifft, ohne zuvor alle potentiell betroffenen Hauseigentümer aufgeklärt zu haben (ich schreibe potentiell, weil der Geltungsbereich noch nicht final definiert ist). Unter Aufklärung verstehe ich hierbei, dass über das Wesen der Erhaltungssatzung sowie ihrer Vor- und Nachteile in hinreichendem Maße informiert wird. Eine kurze 30-minütige öffentliche Informationsveranstaltung am 08.11.2023, direkt vor der besagten Ortsratssitzung, wird dem Thema nicht gerecht. Hinzu kommt, dass sie über die lokale Presse angekündigt wurde, aber einige Hauseigentümer ihren Wohnsitz nicht mehr in Wolfsburg haben und darüber keine Kenntnis erlangen konnten. Einem Pressartikel vom 27.10.2023 konnte ich zwar entnehmen, dass diesbezüglich wohl eine Dorfbegehung und zwei Veranstaltungen stattfanden, aber darüber wurde ich, wie vermutlich viele andere Hauseigentümer, nicht informiert.
Das Landhaus Heiligendorf besitzt keine Bodenplatte und auch die heute üblichen 80cm tiefen Fundamente unter den Außenwänden sind nicht vorhanden.
Bei Herausnahme der Dielenböden im Schlafzimmer dieser Wohnung wurde nur Erdboden vorgefunden.


Ich habe dann ein Mineralgemisch auf den Erdboden eingebracht und dieses mit einem Stampfer verdichtet. Zum Schluss wurde Gussasphalt von einer darauf spezialisierten Firma eingebaut. Gussasphalt ist zwar relativ teuer, aber transportiert keine Feuchtigkeit, ist äußerst tragfest und besitzt eine gute Oberfläche auf der direkt Fliesen oder andere Bodenbeläge aufgebracht werden können.

Im Bild unten wird von der Spezialfirma der flüssig, heisse Gussasphalt in Eimer gefüllt und dann zum Einbauort getragen.

Bei Herausnahme des Estrichs im Badezimmer der Wohnung „Hamburg“ kamen Feld- und Backsteine zum Vorschein.

Die Abbildung unten zeigt das Bad nach Einbau des Gussasphalts. Die noch heisse und weiche Oberfläche wurde mit Sand abgestreut, den ich später entfernt habe. An den Seiten wurden zuvor Schutzstreifen eingesetzt, damit die Rohre nicht beschädigt werden und eine Entkopplung zwischen Boden und Wand vorhanden ist.

Im Flur und in der Küche stellte sich die Situation etwas anderes dar. Estrich war zwar vorhanden, aber nicht durchgehend waagerecht. Ich entschied mich daher Fließestrich in einer solchen Menge darauf zu gießen, bis eine durchgehend plane Oberfläche in einer hinreichenden Dicke (ca. 3cm) entstanden ist. Leider habe ich dabei nicht beachtet, dass zuvor eine geeignete Grundierung auf den Bestandsestrich aufzutragen ist. An Seitenstreifen zur Entkopplung des Bodens mit der Wand habe ich aber noch gedacht.

Der Estrich ist einige Tage später leider gerissen. Auf Nachfrage beim Estrich-Hersteller habe ich erfahren, dass eine mit dem Estrich kompatible Grundierung – satt aufgetragen – hätte aufgestrichen werden müssen.

Ich hatte also keine andere Wahl den gerissenen Estrich wieder auszubauen und zu entsorgen, was äußerst mühsam war. Auch den Bestandsestrich entfernte ich teilweise, um meine Allrounder-Lösung „Gussasphalt“ einzubringen. Auch in diesen Räumen kam Übrigens der blanke Erdboden zum Vorschein.


Wie im Schlafzimmer wurde dann wieder das Mineralgemisch eingebracht und verdichtet.

Im Flur entferne ich den Bestandsestrich übrigens nur im Bereich der Tür, das es ansonsten Probleme mit der Türöffnung gegeben hätte. In der Abbildung unten ist bereits das Mineralgemisch in diesem Bereich eingebracht und verdichtet. Vorne sieht man noch den neuen, aber gerissenen Estrich.

Schließlich wurde wieder der Gussasphalt eingebaut.


Meine Lessons Learned:
Eine Dämmung und eine Fussbodenheizung, wurden im Bodenaufbau nicht berücksichtigt und daraus ergibt sich ein Lessons-Learned. Ist der Einsatz einer Wärmepumpe vorgesehen, so sollte in jedem Fall eine Dämmung und eine Fussbodenheizung mit eingeplant werden. Daraus ergeben sich jedoch noch weitere Kosten, was im Finanzierungsplan einfließen muss.
Den Aufwand für die Böden habe ich bei diesem Renovierungsprojekt absolut unterschätzt und zu Beginn nicht eingeplant gehabt (mit den Belägen sah der Boden okay aus). Erst fast am Ende des Renovierungsprojektes haben diese Arbeiten stattgefunden. Das sind aber Umfänge die ganz am Anfang ausgeführt werden sollten (weil Leichtbau-Wände, Vorwandinstallationen, etc. darauf montiert werden). Das wäre mein zweites Lessons-Learned.
Das dritte Lessons-Learned hatte ich weiter oben bereits erläutert. Es ist immer eine Grundierung, die kompatibel zum Estrich ist, zu verwenden. Ansonsten kann es zu großflächiger Rissbildung im Estrich kommen.
Die Außengefache vom Landhaus Heiligendorf wurden bei der Gebäudeerrichtung mit alten Lehm- und Ziegelsteinen ausgemauert und verputzt. Die verputzten Gefachte schließten bündig mit den Balken ab, so wie es sein muss. Bei Regen kann Wasser in eventuell bestehende Fugen eintreten, es kann aber auch schnell wieder abfließen, d.h. das Wasser kann sich nicht in der Wand halten und Schäden anrichten. Das Foto unten aus dem Jahr 1962 zeigt die beschriebene Hausfassade.

In den 1950er Jahren wurde durch meine Großmutter beauftragt, dass auf die Gefache und den gemauerten Bereich im Erdgeschoss eine weitere Putzschicht aufgebracht wird (mein Großvater konnte diese Aufgaben nicht mehr übernehmen, da er im Krieg gefallen ist). Leider ist das fachlich eine ungünstige Entscheidung gewesen, da die Gefache und die Außenwand im Erdgeschoss nun nicht mehr bündig mit den Balken abschließen und eintretendes Wasser nicht mehr abfließen konnte. Es sind glücklicherweise keine großen Schäden entstanden, da ausschließlich die Ostseite des Fachwerkhauses diese Umgestaltung erfahren hat und diese bekanntlich die Wetter abgewandte Seite darstellt. Das Foto zeigt die weiß gestrichenen Gefache und die weiße Erdgeschoss-Außenwand. Die Giebelwand war durchfeuchtet, da die Dachrinne kein ausreichendes Gefälle hatte und bei jedem Regenschauer überschnappendes Wasser gegen diese Wand gekommen ist. Das äußerte sich in morschen Balken und aufquellenden Putz (siehe das Foto 3).


Um weiteren Schäden vorzubeugen und die bestehenden Schäden zu beseitigen entschied ich mich im Jahr 2020 mit dem Austausch der Gefache und aller Giebelwand-Riegel (das sind die waagerechten Balken zwischen den Ständerbalken). Es war klar, dass in die Gefache Sichtmauerwerk eingebaut wird, da ich zuvor eine genaue Zielvorstellung zum Erscheinungsbild des Fachwerkhauses entwickelt hatte (siehe mein Text auf der Startseite und den gesonderten Blog-Beitrag „Vision“).
Zunächst habe ich die Hauseingangskonstruktion abgerissen, damit ein Gerüst aufgestellt werden konnte. Dann wurde der Inhalt der Gefache herausgenommen und in Container zur Entsorgung befördert.

Mit einem handelsüblichen elektrischen Hobel entfernte ich zunächst die dicken Lack- und Farbschichten auf den Balken. Durch den Lack oder ungeeignete Farbe kann das Holz nicht atmen und zerfällt schneller. Die Alternative wäre eine Bandschleifmaschine gewesen, was jedoch einen zeitlich deutlich umfangreicheres Unterfangen gewesen wäre. Mit dem Hobel (Einstelltiefe 1 – 1,5 mm) waren die Lack- und Farbschichten innerhalb von 3-4 Stunden entfernt, allerdings musste sechs mal das Hobelmesser ausgetauscht werden, weil sich versteckte Nägel in den Balken befanden und der Verschleiß, aufgrund des harten Eichenholzes, ohnehin hoch war. Mit der Bandschleifmaschine mussten nur einige Stellen geglättet oder solche Stellen bearbeitet werden, an welche der Hobel nicht richtig ran kam.
Innerhalb der Gefache an die Balken habe ich dann umlaufend Dreiecksleisten >2cm Höhe eingeschraubt, damit diese ein späteres Herausfallen des Sichtmauerwerks verhindern.

Danach wurden die Ziegelsteine mit Kalkmörtel eingemauert. Bei einigen Gefachen mussten in einer Reihe die Steine aufgrund der Gefachabmaße hochkant gestellt werden. Ansonsten hätte eine Steinreihe entlang der Längskante geschnitten werden müssen, was optisch nicht sehr ansprechend und auch mit einem hohen Aufwand verbunden ist. Wichtiger Hinweis: Besser ist es den Mörtel mit eingesumpften Brandkalk oder Weißkalkhydrat als Bindemittel herzustellen (W. Lenze, Fachwerkhäuser, S. 107). Dabei wurde darauf geachtet, dass zwischen dem Mörtelbett und der äusseren Steinkante ausreichend Raum verbleibt, damit später noch weißes Fugenmaterial eingebracht werden kann. Das Foto 6 unten zeigt die gemauerten Ausfachungen noch ohne Fugenmaterial. Die Giebelmauer wurde mit dem hellgrauen Kalkmörtel verfugt, was mir im Nachhinein nicht hell genug erschien. Die anderen Außenwände habe ich daher mit weißem Fugenmaterial versehen lassen (Foto 7).


Der Gesimskasten wurde sodann mit weißen Brettern verkleidet. Dabei habe ich Rundlöcher für Strahler eingesägt und Kabel in den Gesimskasten eingezogen. Der Einbau der Strahler war dann schnell gemacht.

Zu guter letzt habe ich die Holznägel erneuert und deren Kopf auskragen lassen. Die Balken und die Holznägel galt es dann in weißer Farbe zu streichen. Dabei wählte ich eine Farbe auf Wasserbasis, also ohne Lösungsmittel.

Im August wurde dann noch ein neues traditionelles Badezimmer-Stulpfenster mit Sprossen eingesetzt und eingerahmt.

Eine weitere Besonderheit sind die in Fachwerkhäusern verwendeten natürlichen Materialien, die aus der nahen Umgebung entstammten. Das Fachwerk ist zumeist aus Fichte und Eiche, wobei die Deckenbalken und die Dachsparren aus Fichte und die Wand- und Schwellbalken aus Eiche gemacht wurden. Das Holz durfte nicht zu viele Feuchte aufweisen, da es im Laufe der Jahre austrocknet und Schwund entsteht. Da Eiche zu den Harthölzern gehört, ist es auch nicht einfach zu bearbeiten. Gerade die Herstellung der Balkenverbindungen, das so genannte Zapfen, ist recht aufwändig. Meine These ist, dass diejenigen, die in Fachwerkhäusern wohnen, auch eine gewisse Affinität zu Holz haben und dieses Material zu lieben gelernt haben, sei es aus optischen, atmosphärischen, gestalterischen oder praktikablen Gründen (siehe mein Beispiel von der Hängematte).
In die Wand-Gefache wurden beim Sichtmauerwerk Backsteine oder Ziegelsteine eingebaut und bei verputzten Wänden sind ebenfalls Backsteine, Lehmsteine und teilweiser auch Staken, Geflecht mit Lehmbewurf eingesetzt worden. Die Back- und Ziegelsteine wurden mit Lehm- oder Kalkmörtel gemauert.

In meinem Fachwerkhaus wurden unansehnliche Gesteinsreste verbaut, weil Optik kein Kriterium war und die Gefache verputzt oder die ganze Wand verkleidet werden sollte. Bei den Deckengefachen sind überwiegend Lehm-Wickelstaken eingebaut worden, die dann mit Lehm beworfen, abgezogen und verrieben wurden.

Zusammenfassend kann man sagen, dass in den Gefachen die natürlichen Materialien Ton, Lehm, Stroh, Kalk und Holz (Staken & Geflecht) ihren Einsatz fanden. In einem Beitrag dieses Blogs wird beschrieben, wie ich auf gleiche Weise eine Fassadenwand und einige Innenwände erneuerte und wie die Decke auf alternative Weise, aber auch mit natürlichen Materialien, saniert wurde.
In meinem Fachwerkhaus habe ich im Erdgeschoss, nach Beseitigung von Holzdielen (Schlafzimmer) und Estrich (Badezimmer), nur Erde bzw. Feldsteine vorgefunden. Feldsteine fanden früher auch als Fundamente Verwendung, die den Wänden einen sicheren Halt geben sollten.

In diesem Blog werde ich darauf eingehen, welche (zugegebenermaßen nicht-natürlichen) Materialien beim Landhaus Heiligendorf eingesetzt wurden, damit der Wohnstandard, der von Mietern vorausgesetzt wird, gegeben ist. Nicht-natürliche Materialien kamen hier zum Einsatz, weil natürliche Materialien und deren Einbau aus meiner Sicht unverhältnismäßig aufwändig und die Kosten nicht vertretbar waren.
Fachwerkhäuser haben einen ganz besonderen Charakter. Die Fachwerk-Balken sind zumeist im Inneren sichtbar, ob an Decken oder an Wänden. Deckenbalken können knarzen, wenn auf Ihnen gegangen wird und diese Geräusche werden auch von den Personen unten gehört. Für den einen mag es störend sein, für andere strahlt es Gemütlichkeit und Lebendigkeit aus. Sichtbare Deckenholzbalken strahlen durch ihre Wuchtigkeit Kraft und Stärke, aber auch Wärme aus.
Sichtbare Balken in den Wänden, manchmal sogar mit noch herausragenden Holznägeln an den Verbindungsstellen der Balken, wirken rustikal und idyllisch. Oft wurde in den Gefachen, das ist der Raum zwischen den Balken, Lehm verwendet, was für ein gesundes Raumklima sorgt, da Lehm überschüssige Raumfeuchte aufnimmt und diese bei trockener Luft wieder abgibt. Manche Landhausbesitzer, so damals auch meine Eltern, haben das ein oder andere Gefach von Innenwänden herausgenommen, wodurch allein die Balken noch als Raumteiler fungieren. Die betroffenen Räume wirken größer, luftiger und heller. An den Balken werden dann manchmal Hängematten gehängt oder die Balken dienen als Abstellflächen für Dekorationen.

Fachwerkhäuser können vielseitig genutzt werden. Der vordere Bereich hatte oft eine Scheune und ein großes Eingangstor, damit die Kutschen einfahren konnten, um dort Materialien (Heu, Getreide, etc.) abladen zu können. Die Decke ist in dem Bereich daher deutlich höher als in den anderen Hausbereichen. In den zumeist hinteren Bereichen waren Ställe für Schweine, Kühe oder Hühner untergebracht. Manchmal befand sich, wie in meinem Fachwerkhaus, im Dachboden ein Taubenbeschlag. Menschen und Tiere wohnten also dicht beieinander. Im Dachboden wurde Heu oder Getreide gelagert. Über Seilzüge wurde es nach oben gezogen. Entweder gab es eine solche Vorrichtung in der Scheune oder – wie bei mir – seitlich des Hauses am (dritten) Giebel, der eine Öffnung hatte, die mittels von Klappläden geschlossen werden konnte, über welche das Material in den oberen Speicher gebracht wurde.

Mit der Industrialisierung und dem damit verbundenen Rückgang der Landwirtschaft in Deutschland, wurden die Fachwerkhäuser immer mehr in Wohnhäuser umfunktioniert und die vielseitige Nutzung schwand. Die Fachwerkkonstruktion, die dafür nicht konzipiert war, aber blieb. Aus der Scheune im vorderen Bereich wurde, wie beim Landhaus Heiligendorf, ein Wohnzimmer mit einer (zu) hohen Decke, aus dem Speicher für das Getreide und Heu im Obergeschoss eine Wohnung mit (zu) niedrigen Decken und aus den Ställen hinten wurden ebenfalls Wohnungen mit (etwas) unpassenden Raumquerschnitten. Das zeigt den Korrekturbedarf, mit den sich Landhausbesitzer – im Falle eines Umbaus zum Wohnraum – konfrontiert sahen bzw. immer noch sehen. In meinem Fall sind die Decken von mindestes einer Wohnung im Obergeschoss für normalgewachsene Europäer zu niedrig und müssen höher gelegt werden. In einem Beitrag dieses Blogs wird auch das höher legen der Decke behandelt.
Anfangs hatte ich von einer Vision für das Fachwerkhaus gesprochen die erforderlich ist, um es zukunftsgerichtet zu betreiben. Sie ist aus meiner Sicht wichtig, wenn sich das Fachwerkhaus künftig finanziell selbst tragen und vielleicht sogar einen jährlichen Ertrag erzielen soll. Über die Jahre werden weiterhin Reparatur- und Renovierungsarbeiten erforderlich sein, die Kosten verursachen. Es müssen daher Rücklagen gebildet werden, die – wie in meinem Falle – aus Mietzahlungen gespeist werden. Sollte man mit seiner Familie alleine in dem Fachwerkhaus wohnen wollen, muss eine andere Einnahmequelle gefunden werden (z.B. Einnahmen aus selbständiger oder unselbständiger Arbeit); dann trägt sich das Haus allerdings nicht selber.
Eine Vision für das Fachwerkhaus sollte, neben obigem Aspekt, weiterhin Antworten auf folgende Fragen liefern:
Auf meine Vision zum Landhaus Heiligendorf werde ich in einem gesonderten Beitrag eingehen. Soviel aber vorab: Das Landhaus Heiligendorf ist zur Vermietung von Wohnungen, die einen hohen Wohn- und Energiestandard aufweisen, vorgesehen. Daraus ergibt sich auch ein hoher technischer Standard (siehe Technik des Hauses), aber auch die Berücksichtigung von Balkonen oder Terrassen für jede Wohnung. Dabei sollen Tradition und Moderne vereint werden. Es orientiert sich optisch an Fachwerkhäusern des norddeutschen Raums und ist klar als „Niedersachsenhaus“ erkennbar. Hinsichtlich der Materialien sollen ökologische Materialien zu viel wie möglich und künstlich herstellte Materialien zu wenig wie nötig Verwendung finden.
Liebe Leser dieses Blogs,
in ganz Deutschland haben wir viele noch intakte Fachwerkhäuser, entweder in Dörfern oder in Städten. Überwiegend in Dörfern verfügen sie über wunderschöne Vorgärten mit Pflanzen und einem alten Baumbestand, der zum einen schön aussieht und zum anderen im Sommer angenehmen Schatten spendet. Die Fachwerkhäuser machen den Charakter einer Ortschaft aus und spiegeln das Alter, die Region und die Tradition wider.
In einem kleinen niedersächsischen Dorf bei Wolfsburg wuchs ich auf. Mit meiner Familie wohnte ich einem Landhaus, genau genommen in einem Fachwerkhaus, wie es viele in niedersächsischen Ortschaften gibt. Das Haus mit seinem Charakter, seiner Vielseitigkeit und seinen Materialien hat bis heute bei mir einen starken Eindruck hinterlassen. Schon in jungen Jahren war mir klar, dass Sachverstand (in der Wartung eines Fachwerkhauses), finanzielle Mittel und eine Vision nötig sind, um ein solch großes Landhaus zukunftsgerichtet zu betreiben.
Im Jahre 2018 stand ich mit meinen damals 45 Jahren vor der Entscheidung das große Fachwerkhaus meiner Eltern zu übernehmen. Mein Vater konnte in den letzten Jahren seines Lebens, aufgrund einer Krankheit, nicht mehr viel am Haus machen und einige Schwachstellen traten zutage (von den vielen versteckten Mängeln, die ich erst später entdeckte, ganz zu schweigen). Es war also klar, dass ich meine Arbeitsleistung, neben der Beauftragung einiger Handwerkerfirmen, einbringen muss, sollte die Renovierung in einem einigermaßen akzeptablen finanziellen Rahmen, ohne die Aufnahme eines Kredites, ablaufen. Ich hatte früher mit meinem Vater und Bruder einige Reparaturen und Renovierungen am Haus durchgeführt, die mir Freude bereitet haben, und daraus ist auch meine Leidenschaft im Umgang mit Holz und für das Fachwerkhaus insgesamt entstanden. Die Leidenschaft war also da, aber insbesondere die für die Renovierung erforderliche Zeit musste im Entscheidungsprozess, den ich zusammen mit meiner Frau durchlief, einbezogen werden, hatten wir doch zwei kleine Kinder, die ihren Vater so oft wie möglich sehen und mit ihm was unternehmen wollten. Als einen gangbaren Weg haben wir uns den Samstag Vormittag vorgenommen, an dem ich den Oldtimer „Fachwerkhaus“ wieder in Schuss bringe. Dann war die Entscheidung einfach und nach dem Gang zum Notar begann für mich das Abenteuer „Fachwerkhaus“.
Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén